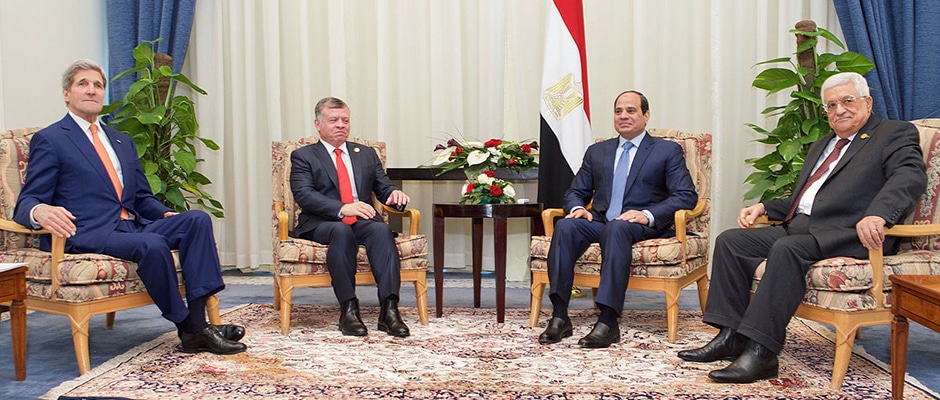
(iz). Throne bersten – Reiche zittern“, dichtete einst Johann Wolfgang von Goethe 1819 in seinem „West-östlichen Diwan“ unter dem Eindruck des Zeitenwandels seiner Epoche. Technologische und politische Innovationen stellten mit hohem Tempo die alten Gesellschaften unter enormen Veränderungsdruck. Politisch blieb der Dichter ein vorsichtiger Mann, der zeitlebens Gewalt hasste, und skeptisch gegenüber der eruptiven Kraft der Revolutionen blieb. Zwar erkannte Goethe durchaus die Notwendigkeit der Veränderung, bevorzugte aber die Idee der Evolution, der langsamen und vorsichtigen Anpassung auf eine sich im Umbruch befindliche Welt.
Wie kaum eine andere Region der Welt stehen der Mittlere Osten und Nordafrika heute für den Untergang alter Ordnungen, für die Hoffnung auf Aufbruch, aber auch für Gewalt und Stagnation. Im Jahr 2010 begann eine Revolte namens „Arabellion“ die Verhältnisse zu erschüttern und Länder wie Tunesien, Libyen und Ägypten zu destabilisieren. Ein Mix aus der Verzweiflung ökonomischer Not und der Unzufriedenheit mit den despotischen Regierungen führten zu dem politischen Willen der Massen, den schnellen Wandel der Verhältnisse herbeizuführen. Heute ist von der Geschwindigkeit revolutionärer Energie kaum etwas zu spüren und Ernüchterung ist eingekehrt.
Inmitten des dramatischen Geschehens ringt auch der „politische Islam“ um die Einordnung der Ereignisse der letzten Jahre und angesichts mancher Desaster, die man mit verursacht hat, um eine neue Eigendefinition. Die Niederlage und Zerschlagung der Muslimbruderschaft in Ägypten, die selbstmörderische Strategie der Hamas in Palästina und die blutige Etablierung des sogenannten „Islamischen Staates“ nähren die Zweifel. In der muslimischen Welt wächst die Skepsis, ob der moderne politische Islam ein Erfolgsmodell ist, oder aber, ob er nicht nur ganz zufällig zu Bürgerkrieg oder Diktatur führt.
Die Frage ist also letztlich, ob der Islam noch politisch sein kann und wenn ja, wie man eine religiös motivierte Politik dosiert oder begrenzt. Es bilden sich bereits neue Facetten des politischen Islam, die eher liberal denken wollen. Die Vertreter dieser Denkrichtung wünschen sich vielleicht eine muslimische Demokratie, aber nicht unbedingt einen islamischen Staat. Viele nachdenkliche Muslime sehen durchaus das Problem, dass eine islamische Partei, die in einem Staat legal die Mehrheit gewinnt, auf Dauer mit einer parlamentarischen Mehrheit ausgestattet, schlussendlich eine Diktatur etablieren könnte. Ein hochgerüsteter Staat, in den Händen von religiösen Ideologen, ist nach den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts wohl für niemanden eine echte Option.
Vielleicht muss man hier kurz innehalten, um das Dilemma des Verhältnisses von Politik und Islam dieser Zeit zu verstehen. Es ist keine Frage, dass die Politisierung der Muslime tatsächlich ein Phänomen der Moderne ist. Der politische Islam, in all seinen Facetten von liberal, konservativ bis hin zu radikalen Strömungen eint dabei im Grunde eine gemeinsame Vorstellung: die Idee des Staates als das Zentrum der Macht. Wie dieser Staat verfasst sein sollte, ob dieser Staat eine Demokratie, eine Diktatur oder gar ein Gottesstaat ist, bleibt dabei eine ganz andere Frage. Jedenfalls steht im Zentrum dieses politischen Denkens der Staat, ganz egal, ob man ihn fürchtet, ihn erobern will oder einfach nur nach Anerkennung sucht.
Um zum Kern des Problems vorzustoßen, müssen wir kurz den Ausgangspunkt der islamischen Welt in Erinnerung rufen. Das Problem ist dabei, die Gründungszeit des Islam mit einer Terminologie des 21. Jahrhunderts zu beschreiben. Der Prophet und seine Gemeinschaft in Medina agierten noch in einem vor-staatlichen Raum, ohne Reisepässe und Grenzen. Die Kernpfeiler der muslimischen Zivilgesellschaft waren das Zusammenspiel von Moscheen, Märkten und Stiftungen und die Etablierung von Gesetzlichkeiten, die man nicht explizit schuf, sondern die der Gemeinschaft durch das Medium des Gesandten offenbart worden waren. Die Herrschaft einer Partei oder einer Ideologie war unter diesen Umständen schlicht unmöglich.
Für den libanesischen Gelehrten Wael B. Hallaq ist deswegen schon die Idee eines „islamischen“ Staates an sich paradox. Moderne Staaten schaffen laufend neues Recht, während vor-staatliche islamische Gesellschaften das maßgebliche Recht bereits als offenbart voraussetzten. In seiner Einführung in das Islamische Recht beschreibt Hallaq die ursprüngliche Kapazität muslimischer Gemeinschaften, ihre eigenen Angelegenheiten ganz ohne Staat zu regeln. Natürlich gab es darüber hinaus auch eine politische Regierung, die aber nur begrenzte und eingeschränkte Befugnisse hatte. Mit der Wirklichkeit des Totalitarismus des „IS“ hatte dieses Gefüge nichts gemein. Auch die Anspielung beziehungsweise der Vergleich, dass ein Führer eines autoritären modernen Staates ein „Sultan“ sei, ist daher abwegig. Sultane waren keine Diktatoren.
Vielleicht lässt sich so erklären, warum liberale Muslime wie der Amerikaner Shadi Hamid insistieren, dass der moderne „Islamismus“ über Jahrhunderte undenkbar und deswegen ein neuartiges Phänomen sei. Für ihn lässt sich der Islamismus in einem Satz zusammenfassen, als der Versuch nämlich, „das vor-moderne islamische Recht mit dem modernen Nationalstaat zu versöhnen“. Eine Versöhnung, will man hinzufügen, die angesichts des neuen Machtrepertoires von Staaten, von Sicherheitstechnik, Überwachung, bis hin zur Existenz von Atombomben naturgemäß auf einige Schwierigkeiten stoßen muss. Der allumfassende und allmächtige Staat jedenfalls, verträgt sich kaum mit dem Anspruch des Islam auf zivilgesellschaftliche Freiheit. Ein Beispiel hierfür ist unter anderem das umfassende Stiftungswesen, dass sich gerade der Verfügbarkeit durch die politische Macht entzieht.
Wahrscheinlich ist es diese Stelle, die auch heute von den politischen Vorstellungen und dem Streit liberaler und konservativer Positionen bestimmt wird. Inwieweit kann das islamische Recht in einer modernen Welt noch Anspruch auf Gültigkeit erheben? Auf der anderen Seite, sozusagen der Seite jenseits der Tagespolitik, ist allerdings klar, dass eine überwältigende Mehrheit der Muslime an offenbarten Glaubenssätzen und Gesetzlichkeiten festhalten will. Die Praxis der Rechtsschulen erlaubt dabei eine Flexibilität und Anpassung an die neuen Verhältnisse, aber ohne die Grundfesten des Islam selbst in Frage zu stellen. Die Idee einer Reform des Islam, die an diesen Fundamenten rüttelt, stößt weltweit auf klare Ablehnung. Wie aber diese Gegensätze auszubalancieren sind und wie man verhindert, dass der Islam und seine Grundlagen „ideologisch“ gedeutet werden, bleibt eine strittige Frage.
Die Balance zwischen den spirituellen, rechtlichen und ökonomischen Seiten der islamischen Lebenspraxis muss, um eine einseitige Politisierung der Muslime zu verhindern, ebenso gewahrt werden. Es ist in diesem Kontext anzumerken, dass sich der politische Islam kaum mit den ökonomischen Gesetzlichkeiten beschäftigt, die der Islam und sein Recht in den eigentlichen Mittelpunkt seiner Lehre rücken. Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass das Verbot von Riba und das Gebot freier Märkte für den machtorientierten politischen Islam bisher eher als eine Machtbeschränkung angesehen wurden. Stattdessen islamisierten die Gründungsväter des politischen Islam lieber flugs die Idee der Bank und des Nationalstaates.
Die einseitige Ausrichtung auf die Macht, oft ohne die Basis einer unabhängigen Zivilgesellschaft, hatte für den politischen Islam durchaus fatale Konsequenzen. Letztendlich konnte die Muslimbruderschaft, nach der kurzzeitigen Erringung der „Macht“ in Ägypten, auch kein schlüssiges ökonomisches Konzept vorlegen. Überhaupt sind die ökonomischen Strategien islamischer Parteien – von der Türkei bis Algerien – wenn überhaupt vorhanden, kaum von der Einsicht geprägt, dass das islamische Wirtschaftsrecht in einer Zeit der globalen Finanzkrise Sinn machen könnte. Vielleicht liegt es daran, dass die Parteien auch keinerlei vom Islam inspirierte, überzeugende zivilgesellschaftliche Projekte, sieht man einmal vom Bau gigantischer Moscheen ab, vorweisen können. Oft genug sind diese Parteien überhaupt nur noch durch muslimische Wähler auf den Islam bezogen.
Interessant für die offene Debatte über eine Zukunft des politischen Islam sind im Moment wohl zwei Länder: Marokko und Tunesien. Die tunesische Ennahda-Partei hat in diesen Tagen gar offiziell den Abschied vom „Islamismus“ verkündet. Die tunesische Abgeordnete Sayida Ounissi erklärt im amerikanischen „Brookings Institute“ den Gesinnungswandel, der endgültig von der alten Bindung an die ägyptische Muslimbruderschaft wegführt. Für Ounissi zeigt die Erfahrung in Ägypten, dass politischer Frieden nur in einem breiten Konsens mit allen Flügeln der Gesellschaft zu erreichen ist. In der Konsequenz sieht sie nun die Ennahda-Partei auf dem Weg, eine konservative Partei – ähnlich wie die europäischen Christdemokraten – zu werden. Wie aber die Ennahda-Partei gleichzeitig ihre ehemaligen islamischen Grundpositionen im demokratischen Prozess erhalten will, bleibt bisher eher vage.
Auch die islamischen Parteien Marokkos scheinen sich von der ägyptischen Muslimbruderschaft endgültig zu emanzipieren. Die politische Situation in der jahrhundertealten Monarchie Marokko ist aber eine ganz andere als in Tunesien. Grundsätzlich garantiert hier der König die islamische, malikitische Ausrichtung des Landes und entscheidet letztendlich auch über die religiöse Verwaltung. Mit dieser Autorität und der Renaissance einer jahrhundertelang erprobten Lehre hat das Königreich inzwischen den ideologischen Wahhabismus aus dem Land gedrängt. Neben dem alteingesessenen König hat sich in Marokko auch eine islamische Partei etabliert, die seit 2011 sogar den Ministerpräsident stellt. Die Parteiführer der „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ hatten zuvor die ursprünglichen Ziele eines rein islamischen Staates aufgegeben und versprochen, den Wahlkampf künftig von den Moscheen fernzuhalten. Im März 2015 verkündete Ministerpräsident Benkirane, dass „Marokko keine Zukunft habe, wenn es einen Konflikt mit seinem König beginne“.
Immerhin ist es dem Land auf diese Weise zunächst gelungen, eine Strategie zu entwickeln, die eine Brücke baut zwischen den islamischen Traditionen der Vergangenheit und den gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit. Wie viele Länder in der Region hat auch Marokko noch keine Antwort auf die Gefährdung des sozialen Friedens durch den ökonomischen Wirbelsturm der Globalisierung gefunden. Aber immerhin scheint die Gefahr von Bürgerkrieg und Terror gebannt. Die Idee, Veränderungen in einer Monarchie auf evolutionärem Weg zu erreichen, ohne Gewalt, hätte wahrscheinlich auch Goethe ganz gut gefallen.
